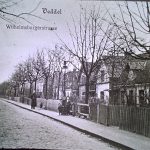Die Veddel feiert 250-jährigen Geburtstag.
Ein kleine Insel mitten in der Stadt.
Für manchen Neu-Veddeler sind die sprachlichen Gepflogenheiten am Anfang sicher ungewöhnlich, denn man wohnt nicht in Veddel, sondern auf der Veddel. Außerdem sagt man „die Veddel“, wenn man über den Stadtteil spricht. Auch ist der Name nicht mit dem berühmten Formel-1-Fahrer Sebastian Vettel zu verwechseln, was aufgrund von „Sprachungenauigkeiten“ passieren könnte. Und so mancher Veddeler rauft sich die Haare, wenn Journalisten die Veddel immer wieder mal nach Wilhelmsburg verlegen. Denn die Veddeler sind stolz auf ihren Stadtteil, auf ihre Zusammengehörigkeit, ihre Multikulturalität, auf ihre kleine Insel inmitten der Großstadt Hamburg. Und nicht nur darauf: In diesem Jahr feiert die Veddel 250-jähriges Jubiläum. 250 Jahre, die voller spannender, interessanter, tragischer Ereignisse den Stadtteil geprägt haben. Gefeiert wird dieses tolle Ereignis am 1. und 2. September mit einem großen Straßenfest, bei der die Brückenstraße zu einer großen Kunst-Mitmach- und Informationsmeile wird (weitere Informationen zum Programm auf Seite ???). Und so wurde die Veddel, wie sie heute ist:
Bereits 1292 wurde die Veddel urkundlich erwähnt und taucht 1568 das erste Mal auf einer Karte auf. Da ist die Veddel noch als Weideland für die Milchwirtschaft gekennzeichnet. Woher der Name kommt, zeitweise auch „Fiddel“ geschrieben, ist nicht genau geklärt. So gibt es Vermutungen, dass der Name auf das bewaldete Weideland – niederdeutsch Wedel – zurückzuführen ist. Aber auch der Ritter „Johannes de Vedhele“ kommt als Namensgeber in Betracht, ebenso könnte man es aber auch auf die lateinische Bezeichnung „vetulae Land“, also altes Land, zurückführen.
200 Jahre später kam die Veddel durch den Gottorper Vertrag am 27. Mai 1768 zu Hamburg, inklusive der Großen Veddel, das heutige Kleine Grasbrook. Bis dahin gehörte die Veddel zu Dänemark. Nachdem man 1888 den Freihafen angelegt hatte, der vom Veddeler Eisenbahndamm bis zum Köhlbrand reichte, wurde der westliche Teil der Veddel, die Insel „Große Veddel“, zum Hafengebiet. Die Insel „Kleine Veddel“ wurde aufgehöht und zum Wohngebiet.
Eine von Kaufleuten gegründete gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft kaufte am 5. Juli 1878 vom Staat zu einem geringen Preis ein Gelände von rund 75.000 Quadratmetern, auf dem ab 1878 Hamburgs erste Arbeitersiedlung in Form einer Gartenstadt errichtet wurde. Sie bestand aus kleinen Einzelhäusern. Benannt wurde sie nach ihrem Initiator, dem Reeder Robert Miles Sloman jr., Sohn von Robert Miles Sloman – Slomansiedlung.
Mit dieser Initiative sollte durch Verbesserung der Lebensbedingungen der Arbeiter das Erstarken der Sozialdemokratie aufgehalten werden. Weitere Arbeitersiedlungen entstanden zur Kompensation des Abrisses des Kehrwieder- und des Wandrahmviertels in den 1890er-Jahren. Auch heute noch erinnern zum Beispiel die Slomanstraße oder der Slomanstieg an den Erbauer der Siedlung. 1928 wurde die Slomansiedlung nach Planung des Oberbaudirektors Fritz Schumacher durch straßenlange Backsteinbauten ersetzt, die noch heute den Stadtteil prägen.
Um 1885 bebaute man den Nordteil der Veddel mit hohen Wohnblöcken, in unmittelbarer Nachbarschaft der neuen Elbbrücken. Das Aus für diese großen Wohnblöcke kam 1938 mit dem Ausbau des Autobahn-Zubringers an den Elbbrücken. Die Häuser folgender Straßen wurden teilweise abgerissen: Tunnelstraße, Veddeler Brückenstraße, Sieldeich, Veddeler Elbdeich, Prielstraße – der Rest der alten Häuser wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört.
Mit der Einweihung der Hamburger Elbbrücken 1887 gab es eine feste Straßenverbindung in die Innenstadt. Dabei hoben die Elbbrücken nicht nur die trennende Wirkung der Elbe auf, die die Veddel von der Innenstadt abschnitt, sondern begeisterten auch durch seine mächtigen Portale, die – in mittelalterlicher Bauart aus Backstein aufgeführt – sich an beiden Enden erhoben. Der Wanderschriftsteller August Trinius (*1851,†1919) schrieb dazu in seinem Buch „Hamburger Schlendertage“ aus dem Jahr 1893: „Die Zinnen der Thürme und Mauern geben dem Ganzen ein vornehmes, burgartiges Ansehen in Hinsicht der Portale, von welchen das Bild eine Anschauung gewährt. Über dem Mittelpfeiler an der Vorderseite des Portals, zwischen den hohen Durchlässen desselben, ist in Stein gehauen das Hamburger Wappen, die drei Thürme, von zwei Löwen als Wappenhalter flanckirt zeigend, angebracht.“
Mit dem Bau der Auswandererhallen im Jahr 1901 bekam der Stadtteil zusätzliche Bedeutung und in den kommenden Jahrzehnten boomte die Veddel. Auf gut 55.000 Quadratmetern in rund dreißig Einzelgebäuden wurden auf Initiative des Reeders Albert Ballin Schlaf- und Wohnpavillons, Speisehallen, Bäder, Kirchen und Synagogen sowie Räume für ärztliche Untersuchungen errichtet. Heute erinnert das Auswanderermuseum BallinStadt an diesen Meilenstein in der Geschichte der Veddel.
Bereits um 1910 sind mehr als 50 Gaststätten vorhanden, in den 1930er-Jahren kommen weitere Bars, Kneipen und Cafés hinzu, unter anderem auch 1932 Matthes Fischbratküche, die heute immer noch unter dem Namen „Veddeler Fischgaststätte“ in der Tunnelstraße zu finden ist. Im Innern der Gaststätte ist die Zeit stehengeblieben: Der Charme der 1970er ist hier mehr als deutlich zu spüren. Aber nicht nur deswegen zieht es die Einheimischen und die Touristen in Scharen an diesen geschichtsträchtigen Ort: Hier gibt es einfach den besten Backfisch in ganz Hamburg!
Während des Zweiten Weltkrieges wurden etwa ein Viertel der Wohnbebauung auf der Veddel zerstört. In den Jahren danach baute man die Häuser nach alten Plänen und in der damaligen handwerklichen Bauweise wieder auf, sodass heutzutage kaum ein Unterschied zu merken ist.
Die Nacht vom 16. auf den 17. Februar 1962, die mit der Sturmflut eine der verheerendsten Naturkatastrophen über die Elbinseln mit sich brachte, war auch für die Veddeler ein einschneidendes Erlebnis: Der Deich an der Harburger Chaussee brach, die Wassermassen erreichten die Veddel. Hier konnten sich jedoch viele Menschen retten, indem sie auf den Bahndamm oder in höher gelegene Häuser gingen.Viele Menschen von der Veddel wurden anschließend evakuiert und kehrten nicht wieder zurück. In den 1980er-Jahren verließen zudem viele alteingesessene Bewohner den Stadtteil, und die Veddel geriet zunehmend aus dem Blickwinkel der Politik.
Mittlerweile hat es in den vergangenen Jahren verschiedene Maßnahmen gegeben, wie zum Beispiel das Studentenwohnprogramm, um die Veddel wieder attraktiver zu machen. Außerdem soll auf dem Kleinen Grasbrook in absehbarer Zeit ein ganz neuer Stadtteil entstehen. Dieser soll gegenüber der östlichen HafenCity entstehen, die Brücke nach Süden auf die Elbinseln schlagen und gleichzeitig den Stadtteil Veddel stärker einbetten.